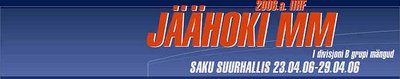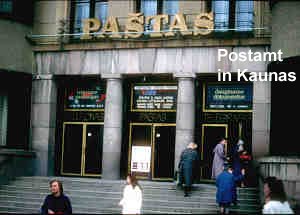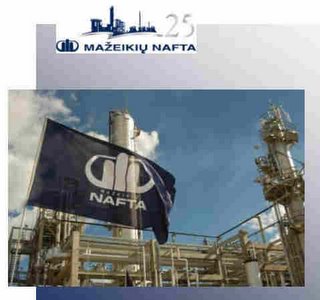Deutschland schaut auf Bremerhaven. Auf Bremerhaven??
Deutschland schaut auf Bremerhaven. Auf Bremerhaven??  Zumindest Basketball-Deutschland, bisher nur auf NBA-Stars wie Dirk Nowitzki fixiert, blickt im Herbst 2005 erstaunt in Richtung Bremische Hafenstadt. Der 44-jährige, aus Litauen stammende Cheftrainer Sarunas Sakalauskas hat seine Mannschaft, die Eisbären Bremerhaven, in den vergangenen Jahren zunächst zu einer Topmannschaft der 2.Bundesliga gemacht, stieg in die bundesdeutsche erste Liga auf, und steht nun in der laufenden dort auf Platz 2.
Zumindest Basketball-Deutschland, bisher nur auf NBA-Stars wie Dirk Nowitzki fixiert, blickt im Herbst 2005 erstaunt in Richtung Bremische Hafenstadt. Der 44-jährige, aus Litauen stammende Cheftrainer Sarunas Sakalauskas hat seine Mannschaft, die Eisbären Bremerhaven, in den vergangenen Jahren zunächst zu einer Topmannschaft der 2.Bundesliga gemacht, stieg in die bundesdeutsche erste Liga auf, und steht nun in der laufenden dort auf Platz 2. "Die Eisbären siegen hoch und stapeln tief" (Schlagzeile auf der Basketball-Fanseite "Schönen-Dunk.de) - so macht die Stadt gerne Schlagzeilen.  Selbst die deutsche Haupstadtpresse schreibt vom "Wunder von Bremerhaven". und erklärt die "Eisbären" sogar schon zum Inhaber von "Platz 1"(hinter Alba Berlin). "Sarunas ist ein sehr ruhiger Typ, der alles akribisch analysiert," so zitiert die Presse Andreas Martin, den Bremerhavener Assistenztrainer. Die Presse schaut Chefcoach Sakalauskas nun sehr genau zu, und zitiert auch einfache Aussagen wie: "Alles ist neu und interessant für uns. Deshalb sind wir besonders motiviert. Das hat uns geholfen".(Sportal) "Sakalauskas sieht keinen Grund, das Saisonziel Klassenverbleib zu korrigieren," schreibt Sport1, und fügt hinzu: "Es scheint, als würde die Liga Bremerhaven schneller kennenlernen, als ihr lieb ist." Nach dem 99:69 Erfolg der Eisbären in Braunschweig formulierte NEWSKLICK: "Die Gedanken schwirrten bei den Braunschweigern noch um die Eisbären, die sie mit Haut und Haaren verschlungen hatten."
Selbst die deutsche Haupstadtpresse schreibt vom "Wunder von Bremerhaven". und erklärt die "Eisbären" sogar schon zum Inhaber von "Platz 1"(hinter Alba Berlin). "Sarunas ist ein sehr ruhiger Typ, der alles akribisch analysiert," so zitiert die Presse Andreas Martin, den Bremerhavener Assistenztrainer. Die Presse schaut Chefcoach Sakalauskas nun sehr genau zu, und zitiert auch einfache Aussagen wie: "Alles ist neu und interessant für uns. Deshalb sind wir besonders motiviert. Das hat uns geholfen".(Sportal) "Sakalauskas sieht keinen Grund, das Saisonziel Klassenverbleib zu korrigieren," schreibt Sport1, und fügt hinzu: "Es scheint, als würde die Liga Bremerhaven schneller kennenlernen, als ihr lieb ist." Nach dem 99:69 Erfolg der Eisbären in Braunschweig formulierte NEWSKLICK: "Die Gedanken schwirrten bei den Braunschweigern noch um die Eisbären, die sie mit Haut und Haaren verschlungen hatten."
Bereits seit 2000 arbeitet Sakalauskas in Bremerhaven, nachdem er mit "Lietuvas Rytas" aus Vilnius erfolgreich war und auch die litauische Meisterschaft holte. Heute lebt Sakalauskas mit Frau Ruta und Sohn Juozas in Bremerhaven, und hat 2004 seinen Vertrag auch um 2 Jahre verlängert. Auch das Umfeld der "Eisbären" hat der Coach ein wenig "litauisch sortiert": mit Vidmantas Slapokas ist ein weiterer Litauer für die Fitness und Athletik der Mannschaft zuständig, und natürlich gibt es bei den Eisbären auch litauische Spieler. Audrius Maneikis wurde aus den USA nach Bremerhaven geholt, Edvaldas Jozys kam aus Belgien, und auch Dainius Miliunas ließ sich aus dem litauischen Basketballparadies, wo die Korbjäger spätestens seit dem Gewinn der Europameisterschaft 2004 fast Volkshelden sind, an die Nordsee locken.
Litauen selbst scheint noch nicht so recht bemerkt zu haben, wie erfolgreich ihr Landsmann ist. Die litauische Basketballseite Krepsinis-Net führt Sakalauskas immer noch als 2-Liga-Trainer. Auf der Homepage der Eisbären Bremerhaven dagegen sind schon Spekulationen zu lesen, der Spitzenklub Litauens, Zalgiris Kaunas, wolle Sakalauskas abwerben. Auf Eurobasket.LT werden die litauischen Fans besser bedient: hier verfolgen die litauischen Deutschland-Korrespondenten aufmerksam das deutsche Sportgeschehen. Ein litauisches Infoportal spekuliert sogar über Sakalauskas als zukünftigem Nationaltrainer in Polen.
Bremerhaven gewöhnt sich gerne an die bundesdeutsche Aufmerksamkeit. So musste vor dem Spiel gegen den amtierenden deutschen Meister Bamberg am 20.11. die Anfangszeit von den für die treuen Fans gewohnten 16 Uhr auf 19.20 Uhr verschoben werden, weil der Pay-TV-Fernsehkanal PREMIERE sich für eine Live-Übertragung entschieden hatte.
 Gegründet worden soll das Unternehmen "Bier-Wanderung" 1999 im deutschen Pottenstein. Zu erklären, wo dieser mystische Ort nun überhaupt liegt, da geben sich die Linux-Freunde auf ihrer internetseite erst gar keine große Mühe. Um so mehr machen sie allerdings bereits vorab Reklame für die zu erwartenden Getränke und Speisen. Große Fotos von Bier, Zeppelini und mehr sollen für das Treffen Mitte August 2006 werben, zu dem sich nach Angaben der Veranstalter jedes Jahr um die 80 Leute aus verschiedenen Ländern einfinden.
Gegründet worden soll das Unternehmen "Bier-Wanderung" 1999 im deutschen Pottenstein. Zu erklären, wo dieser mystische Ort nun überhaupt liegt, da geben sich die Linux-Freunde auf ihrer internetseite erst gar keine große Mühe. Um so mehr machen sie allerdings bereits vorab Reklame für die zu erwartenden Getränke und Speisen. Große Fotos von Bier, Zeppelini und mehr sollen für das Treffen Mitte August 2006 werben, zu dem sich nach Angaben der Veranstalter jedes Jahr um die 80 Leute aus verschiedenen Ländern einfinden. Also: nichts wie auf nach Litauen, lieber Computerfreaks und Linux-Fans! Eine erste Sprachhilfe in Form einer Wortliste Englisch-Litauisch liefern die Organisatoren auch schon mit. Interessenten, die nicht sicher sind, ob sie im August Zeit haben nach Litauen zu kommen, können sich auch auf eine Mailingliste zur Benachrichtigung über weitere Aktivitäten setzen lassen.
Also: nichts wie auf nach Litauen, lieber Computerfreaks und Linux-Fans! Eine erste Sprachhilfe in Form einer Wortliste Englisch-Litauisch liefern die Organisatoren auch schon mit. Interessenten, die nicht sicher sind, ob sie im August Zeit haben nach Litauen zu kommen, können sich auch auf eine Mailingliste zur Benachrichtigung über weitere Aktivitäten setzen lassen.